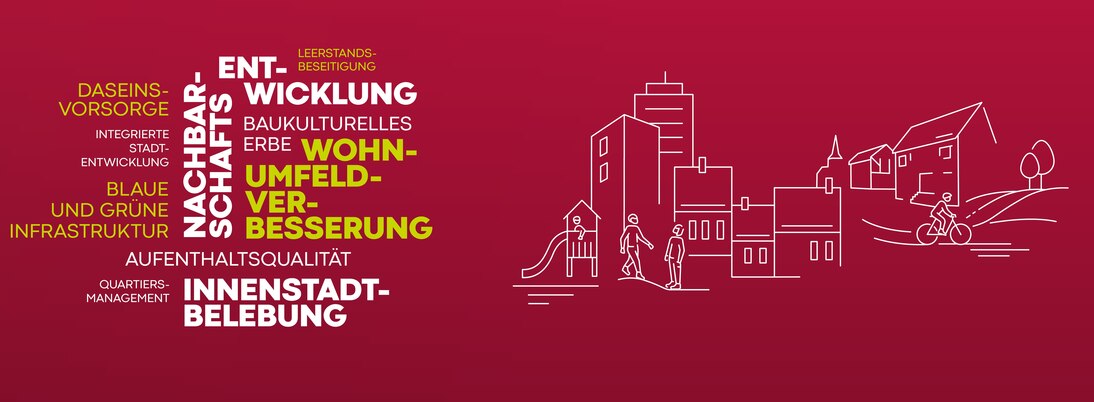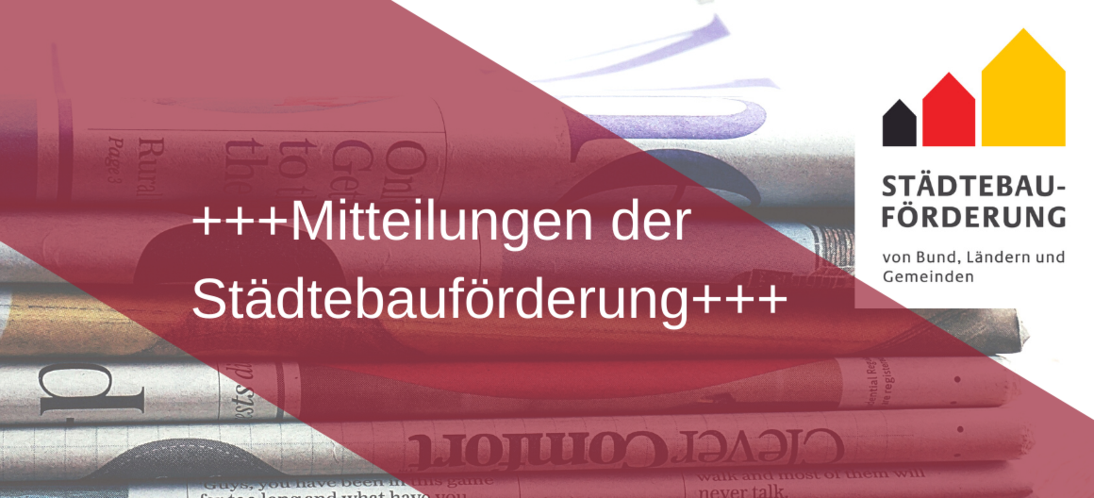Städtebauförderung
Seit 1991 engagiert sich die Städtebauförderung des Bundes und der Länder, sowohl durch Bund-Länder-Programme als auch spezifische Landesprogramme, für die Weiterentwicklung sächsischer Städte und Gemeinden. Ziel ist es, Quartiere, Nachbarschaften und Stadtzentren zu lebenswerten und nachhaltigen Wohnräumen zu transformieren. Diese Förderung hat in den letzten 30 Jahren einen nachhaltigen Beitrag für die sächsischen Städte geleistet. Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von etwa 6,2 Milliarden Euro bisher konnten historische Innenstädte gerettet, Brachflächen belebt und soziale Missstände in den Städten und Gemeinden Sachsens behoben werden.
Ein wesentliches Merkmal, das die Städtebauförderung von anderen Programmen unterscheidet, besteht darin, dass sie nicht nur Einzelmaßnahmen unterstützt. Vielmehr steht ein klar abgegrenztes städtisches Gebiet im Fokus, das als sogenannte städtebauliche Gesamtmaßnahme betrachtet wird. Basierend auf einem im Vorfeld zusammengestellten Maßnahmenbündel verfolgt die Förderung das Ziel, dieses Gebiet als Ganzes in seiner Entwicklung zu attraktiven und nachhaltigen Wohn- und Lebensräumen zu unterstützen.
Die Städtebauförderung wird von Bund und Ländern als Leitprogramm betrachtet, das eine zukunftsorientierte, nachhaltige und moderne Entwicklung von Städten und Gemeinden fördert. Der Handlungsbereich der Städtebauförderung ist breit angelegt und umfasst verschiedene Aspekte, darunter stadtentwicklungspolitische, soziale, wirtschaftliche, kulturelle und zunehmend auch ökologische Ziele.
Ein zentrales Anliegen der Städtebauförderung ist die Aktivierung der Bürgerinnen und Bürger. Durch flexible Kooperations- und Managementstrukturen werden lokale Kräfte und Ideen gebündelt. Damit trägt die Städtebauförderung nicht nur zur Schaffung von öffentlichen Räumen und sozialen Infrastrukturen bei, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe aller.
Städtebauförderung - lernendes Programm
Die Städtebauförderung ist als "lernendes Programm konzipiert" und kann flexibel auf neue Themen und Herausforderungen reagieren. Neben städtebaulichen Impulsen hat sie die Stadtentwicklung als Ganzes beeinflusst. Das Planungsverständnis, das seit Ende der 1990er Jahre verfolgt wird, zielt auf gebietsbezogene, sektorübergreifende und ganzheitliche Lösungen für Entwicklungsprobleme ab. Dies markiert einen Paradigmenwechsel in der Stadterneuerung, weg von rein baulichen Aspekten hin zu Handlungs-, Akteurs-, Ziel- und Zeitdimensionen.
Die Städtebauförderung hat somit soziale, ökologische und ökonomische Fragestellungen in den Fokus gerückt und eine ganzheitliche Perspektive eingenommen. Neben der Städtebau- und Stadtentwicklungspolitik haben andere Politikfelder wie Wirtschafts- und regionale Strukturpolitik, Wohnungspolitik, Umweltpolitik, Jugend- und Bildungspolitik, Integrationspolitik sowie Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik an Bedeutung gewonnen. Die Städtebauförderung strebt eine integrative Diskussion und Koordination dieser Handlungsfelder an, um einen maximalen Nutzen für das Fördergebiet als Gesamtmaßnahme zu erzielen.
Im 4. Quartal 2023 wurde vom Sächsischen Ministerium für Regionalentwicklung (SMR) eine Fachstelle für systeminnovative Gemeindeentwicklung eingerichtet, die die Städte und Gemeinden zu Themen der integrierten Stadt- und Gemeindeentwicklung berät. Neben einem neuen Handlungsleitfaden für die Erstellung integrierter Stadt- und Gemeindeentwicklungskonzepte wird ab dem 1. Quartal 2024 auch eine Online-Plattform zur Gemeindeentwicklung in Sachsen Frag doch INGE! – Die Fachstelle für integrierte Gemeindeentwicklung in Sachsen (inge-sachsen.de) mit vertiefenden Informationen zur Verfügung stehen.
Die Städtebauförderung ist ein Bund-Länder-Förderprogramm zur Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.
Ziele der Städtebauförderung sind insbesondere die Städte und Gemeinden
- als attraktive und lebenswerte Orte zu stärken oder wiederherzustellen,
- bei dem Erhalt ihres baukulturellen Erbes (z. B. Sanierung von Altbauten und Denkmalen) zu unterstützen und sie
- in die Lage zu versetzen, die Maßnahmen umsetzen zu können, die aus den demografischen, wirtschaftlichen, klimatischen und sozialen Entwicklung erforderlich werden.
Wesentliche Kennzeichen der Städtebauförderung sind der gebietsbezogene und integrierte Ansatz – im Gegensatz zur weitverbreiteten Einzelförderung – sowie die hohe Flexibilität der Fördermöglichkeiten in Abhängigkeit der jeweiligen lokalen Bedürfnisse.
Bislang (Stand 2024) konnten hierfür in Sachsen über 6,2 Mrd. EUR an Städtebaufördermitteln den sächsischen Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt werden. Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Städtebauförderung verdeutlicht die Tatsache, dass jeder Fördereuro der Städtebauförderung initiiert durchschnittlich sieben zusätzliche Euro: somit beläuft sich die Gesamthöhe der Investitionen in den sächsischen Städten, angestoßen durch die Städtebauförderung auf knapp 50 Milliarden Euro!
Die Grundlagen für die Bund-Länder-Programme der Städtebauförderung sind im Grundgesetz (GG), dem Baugesetzbuch (BauGB) und entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen zwischen Bund und Ländern verankert.
Rechtsgrundlagen der Städtebauförderung sind insbesondere
- Artikel 104 b GG,
- §§ 164 a und b Absatz 1 BauGB sowie
- die Förderrichtlinie Städtebauliche Erneuerung
Gemäß Art. 104 b GG kann der Bund u. a. zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft Finanzhilfen zur Verfügung stellen.
Daran anknüpfend können gemäß § 164 b BauGB Finanzhilfen eingesetzt werden zur Beseitigung städtebaulicher Missstände und/oder Funktionsverluste. Die näheren Voraussetzungen sind dann in den §§ 136 ff BauGB geregelt.
In den jährlich abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen einigen sich Bund und Länder über Fördervoraussetzungen, -schwerpunkte, die Verteilung der Finanzhilfen sowie den Einsatz und die Abrechnungsmodalitäten der Städtebaufördermittel. Die jährliche Aktualisierung ermöglicht es, flexibel auf neue Herausforderungen im Städtebau zu reagieren.
Das für Sachsen geltende Förderverfahren ist in der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (FRL Städtebauliche Erneuerung – FRL StBauE) vom 7. März 2022 festgelegt.
Die Mittel der Städtebauförderung werden von Bund und Land jeweils zur Hälfte finanziert. Sie stellen in der Regel 2/3 der förderfähigen Gesamtkosten für die Einzelmaßnahmen der Städte und Gemeinden in ihren Städtebaufördergebieten bereit. Die Städte und Gemeinden als Zuwendungsempfänger müssen in der Regel das verbleibende 1/3 der förderfähigen Gesamtkosten tragen.
Die Programme der Städtebauförderung werden jährlich einmal im Sächsischen Amtsblatt ausgeschrieben. Die Antragstellung erfolgt bei der Bewilligungsstelle, die Sächsische Aufbaubank – Förderbank.
Antragsteller in den Programmen der Städtebauförderung können alle Städte und Gemeinden in Sachsen mit mehr als 2 000 Einwohnern sein.
Aktuell gibt es bei den Bund-Länder-Förderprogrammen drei aktive Programme, das Programm Lebendige Zentren, das Programm Sozialer Zusammenhalt sowie das Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung. Bei den ergänzenden Landesprogrammen sind es zwei: das Programm zur Beseitigung von Brachen sowie das Programm zum Rückbau von Wohngebäuden.
Fördergegenstände der Städtebauförderung sind alle investiven Maßnahmen in einer Gemeinde in einem von ihr abgegrenzten Gebiet, die dazu führen, dass städtebauliche Missstände und/oder Funktionsverluste beseitigt oder abgemildert werden. Hierbei ist es erforderlich, dass es sich stets um ein Maßnahmenbündel – also eine Mehrzahl von Einzelmaßnahmen - handeln muss, um eine Förderfähigkeit in der Städtebauförderung zu ermöglichen.
Dieses Maßnahmenbündel kann sich zusammensetzen aus Maßnahmen zur Sanierung von Straßen, Wegen, Plätzen, zur Sanierung von Gebäuden wie denkmalgeschützte Gebäude, öffentlichen Gebäuden wie Rathäuser, Theater, Schulen, Bürgerhäusern, Kindertagesstätten, aber auch Schaffung oder Verbesserung der blauen und grünen Infrastruktur. Die genannten Beispiele sind nicht abschließend. Eine Übersicht zu den wesentlichen, in Sachsen geförderten Maßnahmen können Sie dem Diagramm im nächsten Abschnitt entnehmen.
Die Basis des Monitoring-Systems bilden die in den Bundesprogrammen veröffentlichten Förderdaten zu jeder städtebaulichen Gesamtmaßnahme. Mit den Begleitinformationen, die im Zuge der Programmaufstellung zu jeder Gesamtmaßnahme erfasst werden, und dem Monitoring, das ein Indikatorenset aus Input-, Output- und Kontextindikatoren zu den Gesamtmaßnahmen der Städtebauförderung umfasst, ist der Datenumfang ausgeweitet worden.
Nachfolgend zwei Auswertungen, die den Einsatz der Städtebaufördermittel deutlich machen:
1. Übersicht zur regionalen Verteilung der Städtebauförderung
2. Übersicht zu den wesentlichen Fördergegenständen